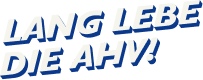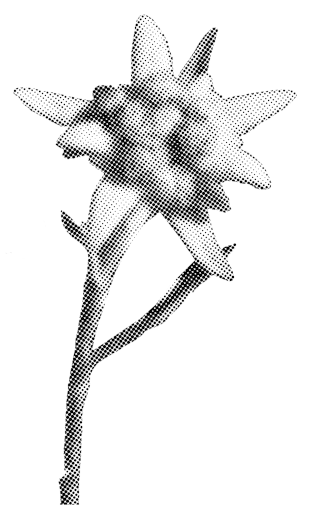Das Dreisäulensystem – einfach erklärt
Die Altersvorsorge in der Schweiz stützt sich auf drei Säulen: die staatliche, die berufliche und die private Vorsorge. Jede dieser Säulen erfüllt eine eigene Funktion und ist unterschiedlich geregelt. Das Dreisäulensystem erlaubt eine bedarfsgerechte Absicherung für verschiedene Bevölkerungsgruppen und sorgt zugleich für eine ausgewogene Verteilung der finanziellen Risiken.
1. Säule: Die Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV
Die AHV sichert den Existenzbedarf bei Wegfall des Erwerbseinkommens durch Alter oder Tod. Sie zahlt Altersrenten sowie Hinterlassenenleistungen (Witwen-, Witwer- und Waisenrenten). Die Rentenhöhe richtet sich nach dem bisherigen Einkommen und der Dauer der Beitragsjahre. Grundsätzlich sind alle Personen, die in der Schweiz wohnen oder arbeiten, obligatorisch versichert.
Die AHV basiert auf dem Umlageverfahren: Die heute wirtschaftlich aktive Generation finanziert die aktuellen Renten. Ein Kapitalstock wird nicht aufgebaut. Beitragspflichtig sind alle in der Schweiz erwerbstätigen Männer und Frauen. Arbeitnehmende und Arbeitgebende tragen die Beiträge je zur Hälfte. Selbstständigerwerbende bezahlen ihre Sozialversicherungsbeiträge selbst. Auch nichterwerbstätige Personen mit Wohnsitz in der Schweiz sind beitragspflichtig. Massgebliches Kriterium für die Beitragsbemessung sind hier die sozialen Verhältnisse.
2. Säule: Die berufliche Vorsorge
Die berufliche Vorsorge soll ermöglichen, den gewohnten Lebensstandard im Alter in angemessener Weise weiterzuführen. Erwerbstätige sind dafür obligatorisch oder freiwillig einer Pensionskasse angeschlossen. Diese werden zu gleichen Teilen von Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern geführt. Gemeinsam legen sie fest, welche Leistungen erbracht werden und wie deren Finanzierung erfolgt – so können sie auf die Bedürfnisse der Versicherten eingehen. Das Gesetz definiert jedoch verbindliche Mindeststandards, die eingehalten werden müssen.
Die berufliche Vorsorge wird im Kapitaldeckungsverfahren finanziert: Die Versicherten zahlen Beiträge ein, die ihre Pensionskasse an den Kapitalmärkten anlegt. Bei der Pensionierung wird das angesparte Kapital in eine Rente umgewandelt. Alternativ kann die versicherte Person verlangen, dass ihr das Guthaben ganz oder teilweise als Kapital ausbezahlt wird. Die genauen Regeln dazu sind im Reglement der jeweiligen Pensionskasse festgelegt.
Im Unterschied zur AHV spart jede versicherte Person für die eigenen späteren Leistungen. In dieser Hinsicht spielt das Verhältnis zwischen Rentnerinnen und Rentnern und Erwerbstätigen keine Rolle. Hingegen ist die steigende Lebenserwartung von Bedeutung, weil die Renten länger ausbezahlt werden müssen. Auch die Teuerung, niedrige Zinsen und Erwerbsunterbrüche führen im Kapitaldeckungsverfahren zu tieferen Renten, weil dann bis zur Pensionierung ein kleineres Guthaben zusammenkommt.
3. Säule: Private Vorsorge
Die private Vorsorge dient dazu, individuelle Bedürfnisse zusätzlich abzusichern. Erwerbstätige können dafür freiwillig Beträge auf ein Vorsorgekonto (z. B. Säule 3a) einzahlen oder eine Lebensversicherung abschliessen. Diese Einzahlungen können bis zu einer vordefinierten Grenze jedes Jahr vom steuerbaren Einkommen abgezogen werden. Neu ist es zudem möglich, Beiträge bis zu zehn Jahre rückwirkend einzuzahlen und diese Einkäufe von den Steuern abzuziehen. Dieses angesparte Kapital ist – mit wenigen Ausnahmen – bis zur Pensionierung blockiert. Danach wird es ausbezahlt und steht zur freien Verfügung.
Die private Vorsorge funktioniert nach dem Prinzip einer Sparkasse: Was eingezahlt wurde, wird im Alter inklusive Zinsen wieder ausbezahlt. Die private Vorsorge setzt voraus, dass jemand über genügend Einkommen verfügt, um regelmässig etwas beiseite legen zu können. Die Höhe der Einzahlungen kann individuell an die finanzielle Situation angepasst werden. Faktoren wie Teuerung und tiefe Zinsen beeinflussen jedoch den Sparprozess und wirken sich direkt auf die Leistungen bei der Pensionierung aus.
Herausforderungen des Dreisäulensystems
Trotz der grundsätzlichen Stabilität steht das Schweizer Altersvorsorgesystem vor Herausforderungen. Besonders ins Gewicht fallen der demografische Wandel und die steigende Lebenserwartung: Menschen leben länger und beziehen entsprechend über längere Zeit eine Rente. Gleichzeitig nimmt die Geburtenrate ab – es stehen immer weniger junge Erwerbstätige zur Verfügung, um Beiträge ins AHV-System einzuzahlen. Das Verhältnis zwischen Rentenbeziehenden und Beitragszahlenden verschiebt sich zunehmend – mit wachsender finanzieller Belastung für die AHV.
Auch die berufliche Vorsorge ist betroffen: Solange im Kapitaldeckungsverfahren der gesetzlich vorgeschriebene Umwandlungssatz die steigende Lebenserwartung nicht ausreichend berücksichtigt, bleibt er zu hoch. Dadurch wird faktisch Kapital von der aktiven Bevölkerung zu den Rentnerinnen und Rentnern umverteilt – was dem Systemgedanken widerspricht.
Diese Entwicklungen machen deutlich: Das Schweizer Vorsorgesystem muss regelmässig überprüft und an veränderte Rahmenbedingungen angepasst werden, um auch langfristig finanziell tragfähig zu bleiben.
Quellen
«Alters- und Hinterlassenenversicherung AHV»: Bundesamt für Sozialversicherungen, 2025
«Berufliche Vorsorge und 3. Säule»: Bundesamt für Sozialversicherungen, 2025
«Ein bewährtes System einfach erklärt: Die schweizerische Altersvorsorge»: Bundesamt für Sozialversicherungen, Dezember 2024, Copyright: BSV, Bern, 2024
«Sozialpolitik – kurz & kompakt»: Schweizerischer Arbeitgeberverband, 2025